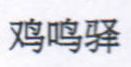Komponistin Carola Bauckholt und Lyriker Jan Wagner
beim Werkstattkonzert „Happy New Ears“
Im Kies beim Kirschbaum knirscht der Giersch – Jan Wagner. Und allerorts raschelt die Goretexjacke – Carola Bauckholt: Im jüngsten Werkstattkonzert des Ensemble Modern im Holzfoyer der Oper sprach der Lyriker mit der Komponistin über den Klang der Welt. Über die konkreten, wie in den Bewegungen von Tieren, die Carola Bauckholt in ihrer Komposition „Treibstoff“ auf Instrumente übertragen hat. Über die Werkzeugklänge, die ihre vergnüglich aufgeführte Komposition „Schraubdichtung“ für Sprechstimme (Paul Cannon), Cello (Eva Böcker), Kontrafagott (Johannes Schwarz) und Schlagzeug (Rumi Ogawa) inspiriert haben. Über die noch konkreteren, die die Streicher Giorgios Panagiotidis, Megumi Kasakawa, Eva Böcker und Paul Canon im (eigentlich für Schlagquartett geschriebenen) „Hirn und Ei“ ihren Wetterschutz-Jacken entlockten: durch Reiben mit der Hand, Kratzen mit der Scheckkarte, mit Händen in die Taschen das Gewebe in Aufruhr bringend, mit Reißverschluss-Glissandi und humorerfüllter Choreographie, alles nach durchkomponierter Partitur. Auch über die vorgestellten Klänge, wie das mit einem Bein im Wasser laufende Tier im Schlagzeugpart von „Treibstoff“. Und schließlich über die verborgenen, mit denen das oben beschriebene Unkraut seinen „Tyrannentraum“ (Wagner) verwirklicht.
Die Faszination für das ganz alltägliche verbindet die 1959 geborene Komponistin und den 1971 in Hamburg geborenen Lyriker. Wobei sie sich im Gespräche darüber einig waren, dass sie die Umwelt beobachten, um sich selbst zu verstehen. Ihre Komposition „Treibstoff“, sagte Carola Bauckholt, untersuche Fragen, wie: Was treibt uns an? Was lässt uns aufhorchen? Was lässt uns anhalten?
Von früher Jugend an habe sie beobachtet, wie der „Überbau“ bröckelt, wie Visionen, Utopien und Systeme zusammenbrechen. So habe sie den Spaß und die Freude am Konkreten an die Stelle abstrakter Ideale: In ihren Kompositionen geht es kaum dramatisch zu. Eher laden sie ein, genauer auf die Klänge der Welt zu hören, um sich an ihr zu freuen.
Bauckholt nährt ihre Entdeckerfreude besonders im Bereich von tieffrequentigen Geräuschen im fruchtbaren Zusammenwirken mit Musikern, etwa mit dem Schlagquartett Köln, oder dem Thürmchen-Ensemble, das sie zusammen mit Caspar Johannes Walter gegründet hat. Und natürlich im Austausch mit anderen Komponisten: Das Scheibchen Kork, verriet sie, das ein Streicher-Pizzicato klingen lässt wie den Ton einer steel drum, hatte sie von dem Frankfurter (Internisten und) Komponisten Thomas Stiegler übernommen. Aus Freude am Zusammenwirken ermunterte sie ihren Gesprächspartner wieder und wieder, eigene Gedichte vorzulesen: das mit der Qualle, der Seife, vom Giersch. Und schließlich, als gemeinsames Statement, das Zitat von Jean Paul: Humor erniedrige das Große und erhöhe das Kleine im Hinblick auf eine Unendlichkeit, in der „alles gleich und nichts ist“.
DORIS KÖSTERKE